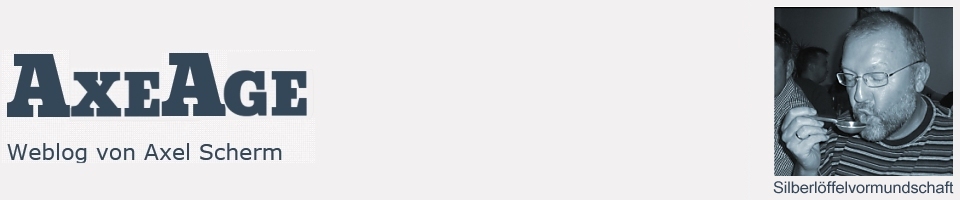Prisoner of War
Hinterlasse einen Kommentar30.11.2016 von axeage
Ewald lag mit dick bandagierter Hand im Lazarett des Lagers, von dem er einst ausgerückt war. Sein Kamerad Erich Vogel, der Hilfe holen wollte, als Ewald verletzt im Wald lag, der kleine Vogel, wie er von Ewald und den anderen Kameraden genannt wurde, war orientierungslos in die falsche Richtung und dem Feind genau vor die Flinten gelaufen. Auch er wurde getroffen. Aber schlimmer als Ewald. Viel schlimmer. Nicht nur ein Streifschuss, sondern Bauchschuss, Steckschuss in der rechten und in der linken Schulter, Oberschenkeldurchschuss. Er hatte offensichtlich sehr laut hier geschrien, als der Herrgott schwere Kriegsverletzungen verteilte. Nur der Kopf war heil geblieben, deshalb konnte er sich auch halbwegs mit Ewald unterhalten, als der ihn am dritten Tag seines Lazarettaufenthaltes besuchte. Erich atmete schwer und unkte Ich glaube nicht, dass ich durchkomme. Dabei zeigte er ein so schmerzverzerrtes Gesicht, dass Ewald selbst Schmerzen verspürte, die über diejenigen seiner verletzten Hand weit hinausgingen. Das Darfst Du nicht sagen, versuchte Ewald zu beschwichtigen, doch das Morphium hatte den kleinen Vogel bereits wieder aus dem Hier und Jetzt geholt und ihn in wundersame, verstörende, lichtgleisende Höhen gehoben. Ewald setzte sich trotzdem zu ihm, hielt seine Hand und erzählte, wie es ihm ergangen war, nachdem Erich ihn verlassen hatte, um Hilfe zu holen. Ich habe noch niemals in meinem Leben so viel Angst gehabt. Ich habe fürchterlich gefroren und dann der Lärm von den Granaten und dem Gewehrfeuer. Und der Geruch. Weißt Du wie es riecht, wenn eine Granate einen Menschen zerfetzt? Wie wenn ein Schlachthaus Feuer fängt. Und dann das Geschrei. Derart verzweifelte Schreie von erwachsenen Männern zu hören ist erniedrigend. So sollte kein Mann schreien dürfen. Das sollte verboten werden. Ich habe nicht geschrien. Ich glaube, ich habe nicht geschrien.
Ewald war sich nicht sicher, ob er das alles dem kleinen Vogel erzählte oder ob er nur tagträumte und fantasierte. Auch er stand unter dem Einfluss schmerzbetäubender, morphinhaltiger Medikamente. Der kleine Vogel wachte ab und zu auf, sah Ewald unverwandt an, freute sich aber, dass jemand bei ihm war, den er kannte und der mit seiner murmelnden Stimme das Stöhnen und die Schreie aus den Nachbarbetten zumindest relativierte. Seine Delirium-Träume waren grellbunt, süß und schrecklich zugleich. In einem seiner hellen Momente sagte er Du musst meine Mutter besuchen und ihr sagen, dass ich nicht gelitten habe. Du musst ihr sagen, dass ich sofort tot war, auch wenn die offiziellen Stellungnahmen der Heeresleitung etwas anderes verkünden. Du musst … versprich es mir …
Ewald wollte nicht daran glauben, dass Erich keine Chance hatte. Er wollte ihm den festen Glauben an ein Leben nach dem Krieg geben, an ein gutes Leben nach dem Krieg, an ein Alles wird gut, aber er selbst glaubte zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr daran. Noch drei Mal besuchte Ewald den kleinen Vogel, dessen Morphiumdosis zum Schluss so hoch war, dass er kaum noch aus dem Delirium erwachte. Die beiden Kameraden, die tags zuvor noch neben ihm gelegen hatten, waren in der Nacht verstorben. Jetzt lagen zwei neue Zerfledderte in deren Betten. Sie waren noch nicht ordentlich versorgt, krümmten sich und schrien. So sollte ein erwachsener Mann nicht wimmern, dachte Ewald, auch wenn es sich bei den beiden eher um Jugendliche als um Erwachsene handelte.
Ewald machte sich in diesen Tagen, da er die letzten Stunden von Erich Vogel begleitete, zum ersten Mal Gedanken darüber, warum das hier alles geschah, wer für diese Misere, in der sich er, der kleine Vogel und all die anderen wimmernden, schreienden, ächzenden Gestalten, die hier zu hunderten bandagiert, eingegipst, zusammengeflickt , mehr tot als lebendig herumlagen, wer für diese Situation verantwortlich war. Es waren erst leise Ahnungen, dann teilweise, sich mehr und mehr bestätigende Erkenntnisse und zum Schluss eine unumstößliche Gewissheit. Als am vierten Tag, an dem Ewald seinen Freund Erich besuchte, dieser seinen letzten Atemzug tat, die Ärzte froh darüber waren, dass sie für diesen aussichtslosen Fall kein Morphium mehr verschwenden mussten, weil sie es für andere, aussichtsreichere Fälle benötigten, als gerade ein Gewitter mit so starkem Regen herniederging, dass die Zeltplanen des improvisierten Lazaretts durchweichten, als die Gewitterdonner sich unheilig mit dem Kanonendonner der Front mischten, als Ewald dem kleinen Vogel die Augen zudrückte und ihm das Kinn hochband, so wie der Arzt, der mit routiniertem Blick den Tod festgestellt und bescheinigt hatte, es ihm aufgetragen hatte, weil er, der Arzt, es selbst zeitlich einfach nicht schaffte, weil die Burschen heute sterben wie die Fliegen, als all das geschah, wusste Ewald plötzlich, dass der Grund für all das einzig und allein bei ihm, beim deutschen Volk, bei dessen sogenanntem Führer zu suchen war. Niemand anderes, als das deutsche Volk, an dessen Wesen die Welt genesen sollte, war schuld daran. Niemand.
Woher diese plötzliche Erkenntnis stammte, konnte Ewald nicht sagen. Vielleicht war es die sanfte Indoktrination seines sozialistisch angehauchten Vaters – Ewald konnte seit seiner Kindheit Die Internationale mitsingen – vielleicht das abschreckende Beispiel seines älteren Bruders, der bei der Waffen-SS war und nicht über seine Tätigkeiten sprechen durfte, aber immer ziemlich vielsagende Andeutungen machte, vielleicht die vielen verschwundenen Nachbarn und Freunde von Nachbarn, von denen man erfuhr, dass sie jüdischer Abstammung waren. Ganz sicher aber waren es die Erlebnisse der letzten Tage und Wochen, bei denen er gelernt hatte, dass der Feind der dort ein paar Kilometer an der sogenannten Front stand, von dem er ursprünglich eine martialisch verbrämte Vorstellung hatte, im Sinne von riesigen, gestählten Mannsbildern, die von Kindesbeinen an mit Wodka und rohem Fleisch aufgezogen worden waren, in Wahrheit aber auch nur Bürschchen wie er und Erich waren, die Angst hatten und noch nie in ihrem Leben eine scharfe Waffe in der Hand. Den Feind, der dem deutschen Volke nur Böses wollte, diesen Feind gab es nicht, im Gegenteil, es gab seit einigen Jahren nur den bösen Deutschen.
Als Erich hinausgetragen wurde und keiner die Frage beantworten wollte, was jetzt mit ihm geschehen würde, dachte Ewald an die Mutter des kleinen Vogel, er dachte an seine eigenen Eltern, an alle Eltern derjenigen, die hier in einem Umkreis von 100 Kilometern damit beschäftigt waren, sich gegenseitig zu vernichten. An die russischen und polnischen Eltern, die im Vorfeld des Krieges wohl geahnt hatten, dass es einen Überfall der Deutschen geben würde und jeden Abend vergeblich dafür gebetet hatten, er möge ausbleiben, an die Eltern der deutschen Soldaten aus nahezu allen Gauen und Reichsgauen, deren Söhne von heute auf morgen eingezogen worden waren, an die Eltern der Eltern, die sich noch an den vorherigen großen Weltkrieg erinnerten. Ewald musste zu Erichs Mutter gehen und ihr sagen, dass Erich nicht gelitten hatte, dass er sofort tot war, nein, dass er zunächst ins Lazarett gebracht worden war, aber dann sofort gestorben sei. Er würde diesen Besuch vorher mehrmals üben müssen, denn eine solche Lüge schüttelte man nicht einfach so aus dem Ärmel. Er würde üben müssen, nicht zu weinen, wenn er nicht gelitten sagte und er würde üben müssen, dies alles mit Überzeugungskraft zu sagen. Mit Überzeugungskraft dachte er, doch Ewald Schramm war im Winter 1943 von überhaupt nichts mehr überzeugt.
Der Krieg war für ihn noch lange nicht zu Ende. Trotz seiner Handverletzung durfte er nicht nach Hause. Er wurde notdürftig versorgt, die Wunde wurde mehr zusammengeflickt, als genäht, dann durfte er sich noch ein paar Wochen ausruhen, einigen wenigen Kameraden bei der Rekonvaleszenz, den meisten aber beim Sterben zusehen und für den 29. Mai 1944, eine Woche vor dem D-Day, bekam er einen neuen Marschbefehl: Stärkung des Atlantikwalls, Einsatzort Belgien.
In der ersten Woche die üblichen Einweisungen und Indoktrinationen. Einen Kameraden, so wie den kleinen Vogel, fand er nicht, die meisten waren viel älter als er und die wenigen Jungen waren kaum zugänglich, einige schwer traumatisiert mit ausgemachten Neurosen und anderen Auffälligkeiten, einige mit ähnlichen Verletzungen wie Ewald und einige so von Hass und fehlgeleitetem Tatendrang durchdrungen, dass sie für eine Freundschaft sowieso nicht in Frage kamen. Die Landung der Alliierten an der französischen Atlantikküste am D-Day sprach sich herum wie ein Lauffeuer. Ewalds Kompanie, die sich auf 25 Strandbunker verteilt hatte, stand vom einen auf den anderen Tag Kopf. Die Kompaniechefs und Offiziere hatten alle Hände voll zu tun, die Disziplin in der Truppe aufrecht zu erhalten. Allenthalben herrschte die Vorstellung, der Krieg würde nicht mehr lange dauern und innerlich bereiteten sich viele von Ewalds Kameraden – auch einige der Verantwortlichen und Truppenführer – darauf vor, sich das Ende zunächst auszumalen, dann sich damit anzufreunden, sich dem Gegner zu ergeben und schließlich sich das Ende konkret vorzustellen und darüber nachzudenken, wie man den Kopf am besten aus der Schlinge zog. Ewald betrachtete in diesen Wochen öfter seine verletzte Hand und kam mit sich überein, man würde ihn schon nicht so hart anfassen, sollte er in Gefangenschaft geraten. Nach circa drei Wochen kreuzten englische Kriegsschiffe vor der Küste, die die deutschen Stellungen nahezu ununterbrochen beschossen. Die Bunker hielten dem Beschuss zwar stand, aber das ewig währende Kanonenfeuer, bei dem niemand mehr zur Ruhe kam, hielt den Stresslevel gleichbleibend hoch. Verstärkt wurde alles noch durch nächtliche Luftangriffe und hinter der Front abgesetzte Fallschirmspringer, die es tatsächlich schafften, in vier Bunker einzudringen, die dortige Mannschaft zu töten und die Geschütze gegen die restlichen Bunker in Stellung zu bringen.
Bis Ende Juli sah sich Ewalds Kompanie also gegen drei Fronten kämpfen: gegen den Himmel, gegen das Meer und gegen die besetzten Bunker, die von den Alliierten aus der Luft mit Munition und Proviant versorgt wurden.
Nach gut drei Wochen Dauerbeschuss stellten sich auch bei Ewald, der bis dahin ruhig, eher stoisch geblieben war, erste Stresserscheinungen ein. Fehlender Schlaf, Todesangst, wenn der eigene – oder ein Nachbarbunker getroffen worden waren, schlechte -, manchmal gar keine Ernährung, weil die Lebensmittelzufuhr unzureichend war, hygienische Mängel, weil Wasser rationiert werden musste und Wäsche zum Wechseln schon lange nicht mehr vorhanden war, ohrenbetäubender Lärm, wenn die Granaten in unmittelbarer Nähe einschlugen und sich der Schalldruck in den Gewölben der Bunker ausbreitete, all das führte erst zu kleinen nervösen Übersprungsreaktionen wie Muskelzucken, Körperjucken und Übelkeit mit häufigem Erbrechen, schließlich aber zu dem Zwang eine anhaltende Aggression im Zaum halten zu müssen, eine Aggression, die einem suggerierte, mit Gewehr und Bajonett bewaffnet, hinausrennen zu müssen und ein Blutbad unter den Feinden anzurichten.
Als zwei seiner Kameraden sich gegenseitig mit ihren Pistolen erschossen, weil sie nach einer Auseinandersetzung keine andere Möglichkeit als den finalen Rettungsschuss mehr sahen, war Ewald weichgekocht. Er hätte all diejenigen, die für den Unbill seines derzeitigen Lebens verantwortlich waren, sofort und ohne mit der Wimper zu zucken, umgebracht. Alle!
Die Heeresleitung beschloss Ende August, den Rückzug anzutreten. Der Beschuss in den letzten Tagen war so heftig, die Moral der Truppe so dermaßen auf dem absoluten Tiefpunkt und die Verluste so hoch – zwei Bunker wurden so stark getroffen, dass die gesamte Mannschaft von insgesamt 61 Mann vollständig ausgelöscht worden war –, dass nur noch eine Möglichkeit blieb: raus aus den Bunkern und zurück ins Landesinnere, wo es hoffentlich besser war.
Aber es war nicht besser. Die wenigen fahrtüchtigen gepanzerten Fahrzeuge boten nur einigen Kameraden Schutz. Die meisten aus Ewalds Bunker und mit ihnen der große Rest, schlugen sich zu Fuß durch und waren bewegliche Ziele für Tiefflieger und Heckenschützen. Mehr und mehr entwickelte sich der Rückzug zu einer unkoordinierten Flucht. Es bildeten sich Gruppen und Grüppchen von zehn bis vierzig Mann, die immer weiter versprengt und getrennt wurden. Auch immer mehr alliierte Bodentruppen mit teils erbeuteten -, teils eigenen Fahrzeugen, begegneten den sich zurückziehenden Einheiten und machten ihnen die Hölle heiß.
Ewald hatte sich einer Gruppe von vierzehn Mann angeschlossen. Ihm ging tagelang das Lied 15 Mann auf des toten Manns Kiste nicht mehr aus dem Kopf. Mit dabei, ein Hundertprozentiger, von allen in der Gruppe nur Tiger genannt. Einer mit Durchblick und Durchhalteparolen, einer, der noch an den Endsieg glaubte und seine Leute zu immer neuen Höchstleistungen aufzustacheln versuchte. Als eine Granate ihm das linke Bein abriss und er es selbst im Todeskampf nicht lassen konnte zu agitieren, wünschten ihm allerdings die meisten, er möge diesen Kampf endlich verlieren, damit dieses unsinnige, nervtötende Gerede aufhörte. Nur Ewald dachte Armes Schwein und wich die nächsten Stunden nicht von seiner Seite. Irgendwann war es soweit, dass der Tiger sich zum zahnlosen Tiger wandelte, sich Todesangst und Delirium zu einer unsäglichen Klage auswuchsen und schließlich nichts mehr übrig blieb, von des Tigers ursprünglicher Kraft und genau das wollte Ewald sehen. Er wollte den Beweis dafür, dass es keine Helden gab, nicht in diesem Krieg, nicht in allen bisherigen Kriegen und in keinem zukünftigen Krieg. Am Ende, so Ewalds Erkenntnis, blieb nur eins: die Angst vor dem Tod, die immer eine Angst vor dem Ungewissen war. Natürlich, dachte Ewald, wusste dieses Nazi-Schwein, das gerade vor ihm lag und bis vor kurzem noch ein Hunderprozentiger war, welche Schuld er auf sich geladen hatte und dass er sich dafür würde verantworten müssen. Nicht vor einem Gott, Ewald glaubte nicht an einen Gott, sondern vor jemandem, der viel mächtiger war als jeder Gott: vor sich selbst. Ewald war sich sicher, der Hunderprozentige hatte in der Stunde seines Todes in einen Spiegel geblickt, und dort ein grausames Nazi-Schwein, einen Blender und Täuscher, einen Seelenverkäufer und Rattenfänger gesehen. Das verrieten die schreckensgeweiteten Augen des Verstorbenen, der jetzt gekrümmt, mit nur noch einem Bein und durchgeblutetem Verband vor ihm lag. Ewald nahm ihm seine Erkennungsmarke ab, überlegte kurz, ob er ihm die Augen zudrücken sollte, verwarf den Gedanken aber wieder, weil er diesen verstörenden, unwirklichen Blick als gerechte Strafe für den Toten und als Mahnung für alle Hundertprozentigen ansah, die alsbald und zuhauf hier an dieser Stelle würden vorbeiziehen müssen, denn an ein Begräbnis war nicht zu denken. Jeder sah zu, dass er schnell weiter kam.
Seine dreizehn Kameraden hatten auf ihn gewartet. Als sie mit ihm weiterzogen, fragten einige, warum er so lange beim Tiger geblieben war, obwohl doch klar gewesen sei, dass es bereits zu spät für ihn war. Ewald antwortete ihnen nicht, stattdessen sang er leise 14 Mann auf des toten Manns Kiste.
Er summte die Melodie dieses morbiden Matrosenlieds Tag und Nacht. Das Lied war für ihn ein Mantra. Wenn er nachts nicht schlafen konnte, oder wenn ihm die Füße brannten, weil die schweren Stiefel drückten, die er jetzt schon drei Wochen ununterbrochen anhatte, oder wenn wieder einer aus seiner Gruppe getötet worden war, immer ließ er einen Kameraden nach dem anderen vor seinem geistigen Auge vorbeiziehen, um dann die erlösenden Worte zu singen: Johohoooo … und die Buddel voll Rum.
Die Zahl der Männer auf des toten Manns Kiste war inzwischen auf 11 geschrumpft. Am 17. September 1944 trafen Ewald und seine Mannen auf zahlreiche andere versprengte Gruppen. Es tobte die Schlacht um das Städtchen Geel. Schweres Artilleriefeuer auf beiden Seiten. Die Stellungen hatten sich eingegraben. Im Osten stand ein Wald in hellen Flammen, aus dem Soldaten flüchteten, die nicht zugeordnet werden konnten. Die Deutschen nahmen sie unter Feuer, um dann festzustellen, dass es eigene Leute waren. Alles war unübersichtlich, chaotisch und unvorstellbar laut, man konnte sich nur schreiend unterhalten. Ein Überlebender aus dem Wäldchen schrie den Verantwortlichen für das Sperrfeuer an, wie so etwas hatte passieren können. Der Offizier schrie den Überlebenden an, warum er und seine Truppe sich nicht zu erkennen gegeben hätten. Ewald schrie den Offizier an, dass er und seine Gruppe von der Küste kämen, der Offizier schrie Ewald an, wo der verantwortliche Offizier sei. Tot, er ist tot, schrie Ewald zurück. Warum sie sich von der Truppe entfernt hätten, wollte der Offizier wissen. Es gab keine Truppe mehr, wir sind alle nur noch um unser Leben gerannt, antwortete Ewald und gerade, als er sagen wollte, seit Wochen rennen wir nur noch um unser Leben, schlug wenige Meter neben den beiden eine Granate ein, die den Offizier in Stücke riss und Ewald schwer an der linken Schulter verletzte. Johohoooo … und die Buddel voll Rum.
Als er gut zwei Wochen nach dem Angriff wieder erwachte, befand er sich in englischer Gefangenschaft in einem Kriegsgefangenenlager nahe Dover. Wieviel Mann auf des toten Mannes Kiste übrig geblieben waren, wusste Ewald nicht und fand es auch später nie heraus. Auf einem völlig überladenen Frachter war er zusammen mit tausenden Kameraden nach England gebracht und dort küstennah in ein eiligst aufgestelltes Lager gebracht worden. Von all dem hatte er nichts mitbekommen. Als er aufwachte, leuchte ihn eine Glühbirne an, die unter einem Lampenschirm, aus dem eine Ecke fehlte, in einer unansehnlich vergilbten Porzellanfassung steckte. Er kannte diese Birne, hatte er sie doch in den letzten Tagen immer wieder in seine Fieberträume eingebaut. Sie war ihm immer dann, wenn er die Augen öffnete erschienen und so zu einem vertrauten Medium geworden, das die köstliche Traumwelt, in die er sich sofort wieder flüchten durfte, mit der realen Welt verband. Die ersten paar Mal, als seine wachen Momente nur wenige Sekunden währten, war sie ein Signal dafür, dass er noch nicht ganz tot war, später dann eine Art Orientierungshilfe, so wie eine Verkehrsampel – ah, das Licht ist wieder da, Traum vorerst zu Ende – und schließlich ein sichtbares Zeichen dafür, dass die Welt noch existierte.
Die Welt. Ewald war sich nicht sicher, ob das Erwachen in dieser Welt ein Segen oder ein Fluch war. Die Schmerzen in seiner linken Schulter, die Geräuschkulisse, die ihn an das Feldlazarett in Polen erinnerte, der Geruch, als eine Mischung aus Exkrementen, fauligem Fleisch, Körperausdünstungen jeglicher Art, Desinfektionsmitteln und gestärkten Leinen. Lieber wäre ihm gewesen, er hätte dann, wenn das alles zu sehr auf ihn einwirkte, immer wieder abtauchen können in seine Träume, die zwar nicht süß und erholsam waren, aber im Vergleich zu dem, was ihn hier in der Welt, hier im Lazarett erwartete, immerhin wesentlich erträglicher.
Nach einer Woche wurden die Narkotika und Morphium-Dosen heruntergefahren und ein Arzt erklärte Ewald in einem Kauderwelsch aus Englisch und Deutsch, dass sich in seiner linken Schulter mehrere Granatsplitter befänden, es aber zu aufwändig wäre, diese zu entfernen. Die Operationstische seien rund um die Uhr besetzt und es gebe wesentlich bedrohlichere Fälle als den von Ewald, das müsse er verstehen. Ewald nickte und verstand. Ewald werde, so der Arzt weiter, damit leben müssen, dass die Splitter in seinem Körper blieben, denn ein späterer Eingriff wäre zu kompliziert, und mit Risiken verbunden, die in keinem Verhältnis zum Nutzen einer solchen Aktion stünden. Ewald nickte und erneut, hielt dem Arzt die Hand hin und sagte Thank You very much. Der Arzt nahm Ewalds Hand in beide Hände und antwortete Your Welcome.
Was für eine außergewöhnliche Antwort, dachte Ewald, zumal unter dem Aspekt, dass bis vor zwei Wochen noch beide Parteien – Engländer und Deutsche – aufeinander geschossen hatten. Das taten sie zwar immer noch, aber jetzt lag Ewald hier in diesem Lager und der einstige Feind versorgte und ernährte ihn. Was für ein Irrsinn, dachte Ewald und schlief erneut ein.
In den folgenden Wochen und Monaten erholte sich Ewald zusehends. Den verletzten Arm trug er in einer Schlinge. Als verletzter Gefangener hatte er das Privileg des Freigangs und durfte mit gekennzeichneter Kleidung am Morgen das Lager verlassen, musste sich aber am Nachmittag spätestens um 17:00 Uhr wieder zurückgemeldet haben. Vom Lager waren es nur wenige Meter bis zum Strand. Ewald machte dort lange Spaziergänge. Am meisten faszinierten ihn die Gezeiten. Er blieb oft den gesamten Gezeitenwechsel, der sich über vier bis fünf Stunden hinzog, am Strand, saß dabei auf einem angeschwemmten Baumstamm und dachte über sein Leben nach. Gerne hätte er dabei Zigaretten geraucht, aber nur selten fasste sich ein Wachhabender ein Herz und gab dem einen oder anderen Gefangenen eine Zigarette, in Ausnahmefällen auch einmal eine ganze Packung. Ewald verstand sich mit den meisten Engländern gut, aber es war ihm zuwider, nach Zigaretten zu betteln, so wie es viele seiner Kameraden taten. Ab und zu gesellte sich ein anderer Freigänger zu ihm, dann teilten sie sich eine Zigarette, aber Ewald blieb oft einsilbig, so dass Besucher nicht sehr lange blieben. In den nächsten Tagen und Wochen wurde Ewald deshalb mehr und mehr zum Einzelgänger mit beinahe misanthropischen Zügen, einer, der kaum sprach und dessen innere Einstellung deshalb keiner kannte, einer, der zwar ab und zu Schach spielte, weil er dies aber so gut konnte, bald kaum mehr jemanden fand, der mit ihm eine Partie wagte, einer, der den ganzen Tag am Strand saß, aufs Meer hinaus starrte und vermeintlich Ebbe und Flut regelte.
Nach vier Monaten platzte das Lager aus allen Nähten. Immer mehr Gefangene kamen an und mussten verteilt werden. Die Engländer berieten sich mit ihren Verbündeten und kamen überein, einen Teil der Gefangenen nach Frankreich und in die Vereinigten Staaten zu schicken. Nach welchen Kriterien die Auswahl stattfand, war nicht bekannt. Ewald musste sich im Vorfeld einer ärztlichen Untersuchung unterziehen, die auch das Ausfüllen eines Fragebogens mit Fragen zu Themen wie Ideologie und Persönliche Einstellung beinhaltete. Er wusste von den geplanten Umerziehungs- und Entnazifizierungsmaßnahmen der Alliierten und beantwortete die Fragen so, dass man ihn höchstens als Mitläufer einstufen konnte.
Mitte April schließlich, gut drei Wochen vor der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Streitkräfte, gab der Lagerkommandant in einer kurzen, für die meisten Gefangenen kaum verständlichen Rede seinen Plan bekannt, die Anzahl der Insassen des Lagers auf ein vernünftiges Maß zu reduzieren.
Was bedeutet reduced considerably wollte einer wissen, der neben Ewald stand. Keiner wusste es genau. Einige glaubten, es würde Exekutionen geben, andere frohlockten, man würde entlassen werden und heim kommen, doch als am nächsten Tag ein Großteil der Gefangenen auf zwei Frachter verteilt wurde, die Tage zuvor in den Hafen eingelaufen waren, war klar, was reduced considerably bedeutete. Ein Frachter ging nach Bordeaux, der andere nach Florida. Ewald war für die Fahrt nach Amerika eingeteilt worden und bereits auf dem Weg an Bord über eine wacklige Gangway-Brücke, war ihm klar, dass dies keine gute Reise werden würde.
Tatsächlich wurden seine schlimmsten Befürchtungen übertroffen. Die Reise dauerte fast drei Wochen und schien unter den an Bord herrschenden Umständen überhaupt nicht enden zu wollen. Die Gefangenen waren im Laderaum des Frachters untergebracht, es gab keine ordentlichen Schlafplätze, nur ein paar Hängematten, die beileibe nicht ausreichten. Toiletten waren überhaupt nicht vorhanden, zwei Löcher am Ende des Laderaums, aus denen es bereits nach zwei Tagen erbärmlich stank, dienten dazu, die Notdurft von über dreihundert Mann aufzunehmen. Essen wurde sehr unregelmäßig verteilt. Ewald nahm an, immer nur dann, wenn von dem für die Mannschaft gekochten Essen genug übrig blieb, bekamen gnädigerweise auch die Gefangenen etwas ab. Das Schlimmste aber war, wie sich manche, eigentlich die meisten seiner Kameraden gebärdeten, wenn Essen verteilt wurde. Natürlich provozierten die Wachhabenden dieses Verhalten, indem sie das Essen manchmal einfach durch eine Luke in den Laderaum warfen und sich dann einen Spaß daraus machten, wenn sich fünfzig oder hundert Mann darauf stürzten, ohne Rücksicht auf den nächsten oder gar diejenigen, die leidend aussahen und Essen dringender benötigt hätten, als diejenigen, die sich mit Ellenbogen und Fäusten darum stritten. Bei jeder Tierfütterung im Zoo ging es gesitteter zu. Ewald beteiligte sich nicht an derartigen Rangeleien. Entsprechend schlecht ging es ihm nach gut einer Woche. Er und noch zahlreiche andere, teilweise verletzte Kameraden waren nach gut zehn Tagen kaum mehr in der Lage aufzustehen. Sie legten sich an den Rand des Laderaums, damit sie bei der nächsten Essenausgabe nicht überrannt wurden und blieben dort einfach liegen. Erst als es einigen von ihnen so schlecht ging, dass mit dem Schlimmsten gerechnet werden musste, fassten sich einige Kameraden ein Herz und kümmerten sich um sie. Auch Ewald wurde unter die Fittiche eines ehemaligen Sturmbandführers genommen. Arnold von Riebenhan, ein Mittvierziger mit kalten Augen, kantigem Gesicht und lauter Stimme, versuchte mit Befehlston und herrischen Gebärden eine Art deutsche Ordnung in das Chaos unter Deck zu bringen. Fünf Tage war er damit auch halbwegs erfolgreich. Ewald und zahlreiche andere Geschwächte bekamen wenn auch wenig, aber immerhin zu essen, auch Wasser, das aus großen Behältern geschöpft wurde und von Tag zu Tag modriger schmeckte. Als dann allerdings die Essensausgabe zwei Tage völlig ausblieb, weil es der Mannschaft und den Wachhabenden so gefiel, brach Chaos im Laderaum aus. Arnold von Riebenhan verlor vollständig die Kontrolle, als am Tag nach der Zwangs-Ernährungspause gekochte Kartoffeln und ein paar Laibe schimmliges Brot in den Laderaum geworfen wurden. Es kam zu einer Massenschlägerei, an deren Ende fünfzehn Schwerverletzte und zwei Tote zu beklagen waren. Von Riebenhan schrie wie ein Wahnsinniger, als er die Bescherung sah, zumal die Mannschaft sich weigerte, die Toten aus dem Laderaum zu entfernen und die Verletzten zu versorgen. Was für eine Bescherung. Das ist ja eine schöne Bescherung schrie der um all seine Macht und Autorität gebrachte Sturmbandführer und als er den Wachhabenden in gebrochenem Englisch unmenschliches Verhalten vorwarf, schrie einer von ihnen zurück You’ve got the nerv to tell us something about human dignity – You? We saw pictures from KZ’s. You don’t have the right to tell us something about human dignity.
Damit war das Thema erledigt. Die Luke wurde geschlossen und bis zum Ende der Reise – immerhin noch fast drei Tage – auch nicht mehr geöffnet. Ewald setzte sich in eine Ecke, zog die Knie an, umfasste sie mit den Armen und schaltete all seine Sinne ab. Er hatte keinen Hunger mehr, er wollte nichts mehr trinken, er roch nicht die Scheiße aus der Kloake und nicht den Verwesungsgeruch der beiden Leichen. Nur sein Gehirn konnte er nicht abschalten. Was wollte der Wachhabende dem Sturmbandführer von Riebenhan sagen? Welche Bilder hatte der Wachhabende vom KZ gesehen?
Am 23. März 1945 legte der Frachter im Hafen von Jacksonville an. Unter den Gefangenen gab es noch ein weiteres Todesopfer. Ein Mann war an den Verletzungen, die er sich bei der Schlägerei zugezogen hatte, gestorben, zwei weitere befanden sich in einem äußerst kritischen Zustand und mehrere Männer, meist Verletzte, waren so erschöpft, dass sie mit Bahren oder von Kameraden gestützt an Land geschafft werden mussten. Ewald biss die Zähne zusammen und schaffte es, ohne fremde Hilfe das Schiff zu verlassen.
Das Lager war dem in England nicht unähnlich, das Wetter hingegen war wesentlich besser: angenehme Temperaturen, viel Sonnenschein und meistens eine leichte Brise vom Meer. Urlaub hätte man hier ganz vorzüglich machen können, in Gefangenschaft allerdings relativierte sich das alles, zumal die Gefangenen keinen Freigang hatten. Die Folge war zermürbende Langeweile und lediglich eine Ahnung davon, dass hinter den Hügeln der Strand und das Meer lagen. Sehen konnte man weder noch.
Die Versorgungslage allerdings war gut, es gab reichlich und abwechslungsreich zu essen und so erholte sich Ewald in den nächsten Wochen mehr und mehr. Als die Orangenernte ihrem Höhepunkt entgegensteuerte, kam die Lagerleitung auf die Idee, die Gefangenen als Erntehelfer einzusetzen. Gesunde sollten Akkord leisten: eineinhalb Tonnen am Tag. Kranke, wie Ewald, sollten den Gesunden helfen, wenn abzusehen war, dass diese ihren Akkord nicht schafften. Das brachte Abwechslung ins Lagerleben, zumal die Leistungen mit Gutscheinen für Zigaretten, Süßigkeiten, Sanitärartikel und andere Annehmlichkeiten entlohnt wurden. Außerdem kamen die Gefangenen endlich einmal raus, weg von der Einöde, weg vom Stacheldraht und den hohen Zäunen, weg von den schmucklosen Mannschaftszelten und den Wachtürmen.
Die Erntezeit ging bis Juni 1945, danach kehrte wieder Langeweile und Ödnis ein, bis schließlich im Rahmen von Umerziehungs- und Entnazifizierungsmaßnahmen Bilder und Filme der größten Kriegsgreuel der deutschen Wehrmacht und schließlich von der Befreiung der Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau und Majdanek gezeigt wurden. Ewald wusste jetzt, wovon der Wachhabende auf dem Schiff gegenüber Sturmbandführer von Riebenhan gesprochen hatte.