AxeAgeRetro – die 80er Jahre
1302.10.2012 von axeage
Wenn mich in den wilden Sechzigern, die mir nicht nur wegen der Fernsehbilder in relativ tumber Schwarz-Weiß-Erinnerung sind, jemand gefragt hat, ob ich denn einmal studieren wolle, habe ich geantwortet Nein! Als Student muss man ständig demonstrieren. Dabei war mir damals weniger der Umstand ein Greuel, dass demonstrierende Studenten von Polizisten mit Tränengas und aus Wasserwerfern traktiert wurden, als die Tatsache, dass dieses arbeitsscheue, langhaarige Gesindel nix besseres zu tun hatte, als sich auf den Straßen herumzutreiben, um gegen den von der Yellow- und Springerpresse, sowie meinen Eltern hoch geachteten Schah von Persien aufzumarschieren. Meine Eltern haben sich damals furchtbar darüber aufgeregt – wohlgemerkt über die Studenten, nicht über den Schah – dass ich der Meinung war, Student sein sei mindestens so schlimm wie Einbrecher, wenn nicht schlimmer.
Im Herbst 1980 war ich dann aber doch Student. Langhaarig sowieso und ein wenig arbeitsscheu auch.
Als ich meinen Studentenausweis im Sekretariat abholen wollte, traf ich erst einmal auf Walter. Walter sollte mir im Laufe meines Lebens noch öfter über den Weg laufen und hatte, ohne dass mir dies zu diesem Zeitpunkt klar war, bereits in meiner Vergangenheit eine gewisse Rolle gespielt, aber das gehört nicht hier her. Walter ist inzwischen der Nachbar von guten Freunden von uns und Walter war damals wie ich Erstsemestler. Er hatte im Sekretariat gerade seinen Studentenausweis abgeholt und sprach mit den Leuten im Büro auf so präsente und eloquente Weise, dass ich einerseits tief beeindruckt und andererseits sofort und nachhaltig sicher war, hier, an dieser Hochschule richtig zu sein. Hier trat einer auf, der es gewohnt war, vor Leuten zu sprechen und der das gefälligst auch in den nächsten Jahren seines Studiums und bestimmt auch darüber hinaus tun würde. Walter studierte Sozialpädagogik und noch wusste ich nicht, dass ich während meines Studiums mit Menschen aus diesem Dunstkreis mehr und intensiveren Kontakt pflegen würde, als mit meinen Mitstudenten aus dem Fachbereich Betriebswirtschaft. Außerdem war mir nach dieser kleinen Sekretariatsszene klar, dass sich hier Studenten, Hochschulangestellte und Dozenten auf Augenhöhe begegneten und nicht, wie in der Schule, in einer Art Vorgesetzten-Untergebenen-Verhältnis. Sehr wohltuend!
Ich verließ das Sekretariat, verstaute den Studentenausweis in meinem Geldbeutel, kaufte mir in der Cafeteria einen Kaffee, steckte mir eine Zigarette an – ja das ging damals noch: in der Hochschule rauchen – und hatte plötzlich ein Freiheitsgefühl, wie ich es vorher nie und nachher kaum in meinem Leben hatte. Ich besaß ein eigenes Auto, ich hatte eine eigene Studentenbude, einen gültigen Studentenausweis und ich bekam ein paar Mark Bafög. Ich war jung, ich war frei und ich hatte Zigaretten. Ich war an diesem Tag der glücklichste Mensch der Welt.
+++++++++
Ein Telegramm hat mein Leben verändert. Das klingt pathetisch und die Jüngeren werden gar nicht mehr wissen, was ein Telegramm ist. Aber tatsächlich flatterte eines Nachmittags in die neubezogene Studentenbude einer Mitstudentin aus dem sozialpädagogischen Umfeld ein Telegramm mit folgendem Text:
Heute abend Foundue +++ STOP +++ Ruf doch mal an +++STOP +++
Ein Mitstudent aus dem betriebswirtschaftlichen Umfeld hatte ihr dieses Telegramm geschickt, weil es in der neubezogenen Studentenbude noch kein Telefon gab. Die Mitstudentin rief also brav an, sagte, dass sie nicht kommen könne, weil ihr Freund, ein anderer Mitstudent aus dem betriebswirtschaftlichen Umfeld mit dem sie in die Studentenbude neu eingezogen war, wegen eines Fußballspiels verhindert sei. Daraufhin bot ihr der einladende Mitstudent an, mich(!) – quasi als Ersatzmann – einzuladen und schon war die Mitstudentin überredet. Denn ich(!) hatte seit der Einweihungsfeier besagter Studentenbude, die ein paar Tage vorher stattgefunden hatte, eine Postkarte in meiner Brusttasche, auf der stand: Axel, ich mag Dich!. Und diese Postkarte hatte ich nicht von irgendwem, sondern von ebenjener Mitstudentin bekommen.
Der Fondue-Abend verlief kurios. Die Mitstudentin und ich kamen uns immer näher. Die Blicke der Gastgeber und der anderen Gäste wurden immer skeptischer. Die Frage, ob ich bei den Gastgebern übernachten sollte, wurde immer dringlicher und ich beantwortete sie mir nach einer zwanglosen Schnapsrunde selbst mit „Ja“. Die Frage der Gastgeberin, ob wir, die Mitstudentin und ich, moralische Bedenken hätten, gemeinsam in einem Zimmer zu übernachten mit „Nein“.
Das Sofa und das Gästebett, das uns die Gastgeber brav getrennt voneinander bereitet hatten, haben die Mitstudentin und ich nicht benutzt. Wir haben uns die ganze Nacht gegenseitig unser bisheriges Leben erzählt und uns unser gemeinsames, zukünftiges Leben bis in alle Einzelheiten ausgemalt. Im Morgengrauen sind wir dann Hand in Hand dem Sonnenaufgang entgegen spaziert und die Zeit bis zum Frühstück haben wir küssend auf einer Parkbank überbrückt.
Beim Frühstück haben wir die Gastgeber und die anderen Übernachtungsgäste über die „neue Situation“ informiert. Ja, das habe man sich gestern beim Fondue schon gedacht, dass da was im Busch sei und auch der Umstand, dass wir uns die ganze Nacht unterhalten hätten, was offensichtlich im ganzen Haus zu hören war, sorgte dafür, sich einen Reim auf den Ausgang dieser Geschichte machen zu können.
Dann sind wir zur neu bezogenen Studentenbude gefahren und die Mitstudentin hat ihrem Freund gesagt, dass sie heute bei ihm aus- und bei mir einziehen würde. Ich hatte ein wenig Angst, denn ihr Freund war nicht nur Student der Betriebswirtschaft, sondern auch ein bei der Bundeswehr ausgebildeter Einzelkämpfer. Ich glaube, er musste sehr an sich halten, mich nicht auf der Stelle zu Brei zu schlagen. Aber er hat mich am Leben gelassen.
Die Mitstudentin aus dem sozialpädagogischen Umfeld und ich haben Ende der 80er Jahre geheiratet.
Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei; ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei.
Beim Traugespräch hat die Liebste diese Zeilen beim zuständigen Pfarrer moniert und gefordert, dass wenn dieser unsägliche Spruch schon sein müsse, er, der Herr Pfarrer doch bitteschön „Mann“ und nicht „Mensch“ sagen möge. Der Pfarrer hat sich herausgeredet, irgend etwas von festgelegter Formel, Tradition und dergleichen gefaselt und um das Unternehmen Hochzeit nicht zu gefährden, hat die Liebste nachgegeben. Ich, der Mensch, blieb also nicht allein und sie, die Liebste, wurde meine Gehilfin und ist seither um mich.
+++++++++
Die Liebste und ich bewohnten eine kleine Studentenbude mit einem Hochbett. Unter dem Hochbett befand sich unsere Küche. Als Tisch diente eine billige Baumarkttür, die wir mit Eisenwinkeln an zwei der Hochbettbalken und an der Wand befestigt hatten. An die Wände hatten wir Obstkisten geschraubt und unsere Klamotten wohnten nicht in einem Schrank, sondern in einer Truhe.
Die Hochschule war über eine lange Treppe in ca. zehn Minuten zu Fuß erreichbar. Wir waren keine eifrigen Vorlesungsbesucher. Wir lagen lieber mehr oder weniger beschäftigt bis in den späten Vormittag in unserem Hochbett.
Eines Morgens hatte die Liebste einen Termin, quälte sich aus dem Bett, trank eine schnelle Tasse Kaffee, rauchte eine schnelle Zigarette und verschwand. Natürlich nahm ich an, dass sie zu Fuß zur Hochschule ging und war erstaunt, als sie nach gut einer viertel Stunde wieder im Zimmer stand.
„Was ist los“, wollte ich wissen.
„Es war kein Parkplatz frei“, antwortete sie und kam zurück ins Bett gekrochen.
+++++++++
Informationstechnologie hieß in den 80er Jahren noch Datenverarbeitung. Plattenlaufwerke mit 25 Megabyte Speicherkapazität hatten das Gewicht und die Größe einer Waschmaschine, Disketten die Konsistenz und Größe von Schellack-Platten. Laser- oder Tintenstrahldrucker gab es noch nicht, gedruckt wurde auf nervig ratternden Nadeldruckern, in denen grün-weiß-liniertes Endlospapier eingespannt war. Damit wurden kilometerlange Listen erzeugt, auf denen entweder Lagerbestände mittelständischer Firmen oder der in COBOL oder PASCAL geschriebene Programmcode dokumentiert war. Bildschirme hießen Datensichtgeräte und quälten das Auge mit bernsteinfarbener – oder giftgrüner Schrift auf schwarzem Hintergrund.
Grafik erinnerte entfernt an Legofiguren und mit dem stündlichen Stromverbrauch eines Computers mittlerer Datentechnik könnte man heutzutage mehrere hundert Laptops drei Jahre lang betreiben. Das einzige, was nicht so war, wie in amerikanischen Filmen gerne dargestellt, war die sich zeichenweise aufbauende Schrift auf dem Bildschirm und das dazu gehörige Knispelgeräusch. Bildschirme bauten sich damals schon seitenweise auf.
In dieser halbdigitalen Übergangszeit machten Studienkollege Waldemar und ich ein Praktikum bei einer kleinen Brauerei am Rande der Stadt. Und weil wir beide damals schon der neuen Technik zugetan waren – heutzutage würde man uns wahrscheinlich Nerds nennen – und die Brauerei gerade ein neues Pilsbier auf den Markt gebracht hatte, kam uns die Idee, als Praktikumsarbeit eine Marktbefragung über den Erfolg des neuen Bieres durchzuführen und die Ergebnisse dieser Befragung von der Datenverarbeitungsanlage unserer Hochschule auswerten zu lassen.
Unser DV-Dozent verstand zwar kein Wort, weil ihm das alles zu praxisnah war, genehmigte aber trotzdem freudestrahlend unser Vorhaben und Waldemar und ich waren Feuer und Flamme, diese Arbeit zu einem bahnbrechenden und richtungsweisenden Betriebswirtschafts-Projekt an unserer Hochschule werden zu lassen.
Die Fragebögen tippten wir auf einer Schreibmaschine auf sogenannte Matrizen, die dann über eine berauschend nach Alkohol riechende Apparatur auf Papier von ausgesucht schlechter Qualität vervielfältigt wurden. Die notwendigen Software-Installationen hatten wir im Vorfeld der Befragung in mehreren Sitzungen, ohne groß zu fragen, im Rechenzentrum vorgenommen. Dann sind wir, ausgestattet mit mehreren hundert, nach Alkohol riechenden Fragebögen in die Fußgängerzone unserer kleinen Hochschulstadt gezogen und haben der Fußgängerzonenbevölkerung Löcher zum Thema Bier im Allgemeinen und Prinz-Albert-Pils im Besonderen in den Bauch gefragt.
Wenn sich Passanten störrisch zeigten und mir nachhaltig Auskunft verweigerten, habe ich auch schon einmal ausnahmsweise den einen oder anderen Bogen selbst beantwortet. Es kam ja weniger auf das Ergebnis, denn auf die ausgeklügelten EDV-Methode an, dieses Ergebnis auszuwerten und vor der Geschäftsführung der kleinen Brauerei am Rande der Stadt zu präsentieren.
Als wir also nach gut einer Woche intensivster Marktbefragung mit einem Stapel ausgefüllter Fragebögen im Rechenzentrum erschienen und uns einloggen wollten, erschien dort die Meldung: Zugriff verweigert. Ich fragte einen neben mir sitzenden Studenten aus dem technischen Umfeld, was es denn mit der Verweigerungshaltung des Rechners auf sich hätte. Daraufhin antwortete dieser verächtlich. „Irgendwelche Betriebswirtschaftler wollten über das Rechenzentrum ihre Bierdosen auswerten, deshalb wurde das Passwort geändert“.
Also mussten Waldemar und ich beim Leiter des Rechenzentrums vorsprechen und schriftlich unser Ansinnen formulieren. Die drohenden Rechnerkosten für die maschinelle Auswertung, die ja nun keine wissenschaftliche mehr war, sondern eine kommerzielle, ließen uns schwindeln, so als hätten wir all die vielen Biere selbst getrunken, die uns die Marktbefragten im Vorfeld genannt hatten.
Zum Glück hat unser praxisferner EDV-Dozent interveniert und wir wurden von den Rechnerkosten befreit. Unsere Auswertung und die anschließende Präsentation der Daten wurden ein voller Erfolg und für ein paar Wochen fühlten wir uns wie Bill Gates und Steve Jobs, ach was: wir waren Bill Gates und Steve Jobs!
+++++++++
„Wir Deutschen sind jetzt das glücklichste Volk auf der Welt“ sagte Berlins regierender Bürgermeister Walter Momper am 10. November 1989 in der Tagesschau. Ich saß an diesem Abend zusammen mit der Liebsten und einem befreundeten Ehepaar irgendwo im Mainfränkischen in einem gut bürgerlichen Landgasthof, ließ mir Entenbraten, Knödel und Landbier schmecken und gehörte damit durchaus ebenfalls zu den glücklichen Deutschen. Übrigens nicht nur wegen des Entenbratens und der Maueröffnung, sondern vor allem, weil ich an diesem Tag zum ersten Mal in meinem Leben einen Golfschläger geschwungen hatte, während dreihundert Kilometer weiter meine Mutter im grenznahen Bayreuth wildfremde Menschen mit ungewöhnlichen Dialekten, die an diesem Tag zahlreich die Oberfrankenmetropole bevölkerten, mit Bananen und Süßigkeiten beschenkt hatte.
„Du hast ihnen Bananen geschenkt?“, fragte ich meine Mutter später ungläubig und wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte.
„Ja“, antwortete sie treuherzig, „… und die haben sich sehr darüber gefreut.“
Ich war froh, an diesem Tag nicht an einem der zahlreichen Ossi-Begrüßungsorte gewesen zu sein, sondern stattdessen dem aus DDR-Sicht bourgeoisesten aller Sportarten gefrönt zu haben.
Man kann jemandem, der noch niemals Golf gespielt hat und der mit dem Vorurteil lebt, dies sei ein Altherrensport, nicht erklären, welche Faszination von diesem Sport ausgeht. Und diejenigen, die sich schon einmal daran versucht haben, werden bestätigen, es gibt nur zwei Möglichkeiten: entweder man kann damit überhaupt nichts anfangen oder man kann es nicht mehr lassen und wird süchtig danach. Dazwischen gibt es nichts. Man kann Golf nicht halbherzig oder nur ab und zu spielen. Ich jedenfalls wurde süchtig. Zwar hatte das, was ich am Tag der Maueröffnung im November 1989 mit meinen Golfschlägern anstellte, nur entfernt etwas mit Golfspiel zu tun, aber ich ahnte damals schon, dass ein perfekter Golfschwung eine Art religiöse Erfahrung sein konnte. Es hat nicht lange gedauert, bis sich diese Ahnung bei einem USA-Urlaub bestätigte. Später waren es nicht mehr nur einzelne Schläge, sondern ganze Golfrunden. Und wenn ich heute nach vier oder fünf Stunden auf dem Golfplatz den Weg zum Parkplatz, der über dem 16. Grün untergehenden Sonne entgegen gehe, dann …
… bevor ich noch weiter ins Schwelgen gerate, Fortsetzung demnächst in der Kategorie AxeAgeRetro.
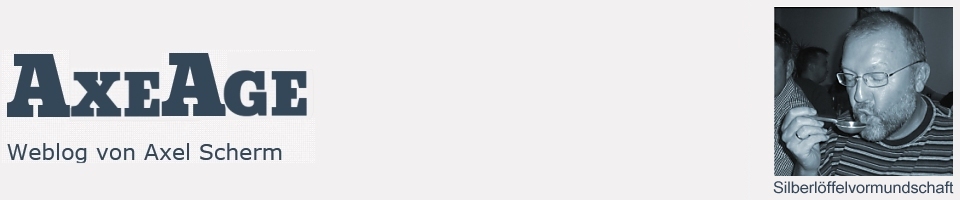
Ich freue mich, dass die Geschichte, wie die Liebste einmal studieren wollte und keinen Parkplatz fand, hier verewigt ist.
PS.: Wir haben uns damals wirklich über Bananen aka Südfrüchte gefreut. Und über Raider. Und Milka. Und Bounty. Und Mars. Und Wrigleys. Und Sncickers’s. Und Duplo. Und ja, wir sahen scheußlich aus.
Wunderbar.
Ich erinnere mich an die Trabbis in der Hamburger Innenstadt, die von erwachsenen Menschen umschwärmt wurden wie sonst nur Porsches von Dreikäsehochs. Einigen parkenden Exemplaren hatten wohlmeinende oder höhnische Menschen Bananen hinter die Wischerblätter geklemmt. Es war eine merkwürdige Zeit. Und ja, cw, wir sahen alle scheusslich aus, ob aus Ost oder West.
[…] AxeAgeRetro – die 80er Jahre „Ich verließ das Sekretariat, verstaute den Studentenausweis in meinem Geldbeutel, kaufte mir in der Cafeteria einen Kaffee, steckte mir eine Zigarette an – ja das ging damals noch: in der Hochschule rauchen – und hatte plötzlich ein Freiheitsgefühl, wie ich es vorher nie und nachher kaum in meinem Leben hatte. Ich besaß ein eigenes Auto, ich hatte eine eigene Studentenbude, einen gültigen Studentenausweis und ich bekam ein paar Mark Bafög. Ich war jung, ich war frei und ich hatte Zigaretten. Ich war an diesem Tag der glücklichste Mensch der Welt.“ […]
Das klingt jetzt vielleicht total schräg, aber weißt du, worüber ich mich mehr als über alle „exotischen“ Früchte und bunten Süßigkeiten gefreut habe? Über Mülltüten – ungelogen!
@cw
Kanntest Du die Geschichte, wie die Liebste einmal studieren wollte und keinen Parkplatz fand etwa schon? Kann es wirklich wahr sein, dass ich diese Geschichte schon einmal erzählt habe? Unmöglich!
@Kiki
Bei Gelegenheit erzählst Du mal Deine Als-ich-zum-ersten-Mal-Golf-gespielt-habe-Geschichte ja?
@iris
Ähm – Mülltüten?
@axel: Ja, Mülltüten! Gab es nämlich nicht. War immer eine herrliche Sauerei im DDR-Mülleimer. Man konnte auch nicht einfach die Rewe-Einkaufstüten nehmen. Rewe gab es nicht, und auch keine Einkaufstüten. Wir hatten Dederon-Beutel und Einkaufsnetze. Für den Konsum. Oder den Delikatladen, der bei uns auch „Fressex“ hieß.
@kiki: Sooooooooooooooooo scheußlich habt Ihr nicht ausgesehen. Und Ihr habt damals bestimmt auch nicht im Trainingsanzug eine Grenze – sagen wir Dänemark – überquert. Wir schon. Auf alten Aufnahmen sehe ich immer nur Jeansjacken, Oberlippenbärte und Vokuhila.
e13 sagt es. Die Sätze stehen für alles. Große Axelatur!
Gruß von Sonja
[…] Axel Scherm über früher, die Achtziger, das Kennenlernen der richtigen Frau, das Studieren ohne Ambition, Heiraten nach altem Muster und Bananen in Deutschland. Hätte auch für einen Roman gereicht. […]
@Axel: Ja, wird gemacht. Im Teaser. 😉
@cw: Sagen wir so: ich erinnere mich an eine Anzeige im Rolling Stone Magazine 1986 oder 87, bei der für Lee Frosted Rider Jeans geworben wurde. Das waren moonwashed Jeans, die zu der Zeit als der hippe Shyce etabliert wurden und drei Jahre später nur noch von Ossis getragen wurden. Wir sahen als höchstens früher scheußlich aus. 😉
Ach ja, das waren Zeiten… Das ist mal wieder ein richtiger „Axel“, das würde echt für einen Roman reichen (schon mal drüber nachgedacht oder leidet darunter das Handicap?), einiges kam mir jetzt nicht unbekannt vor, da ich ja eine weitere Quelle habe, die mich doch etwas über die 80er und Dein Leben zu jener Zeit informiert. 😉
Die Hände der Quelle sind dem geübten Auge auf meinem aktuellen Blogbeitrag erkennbar. Mit Stäbchen. 🙂
[…] Die 80er Jahre […]